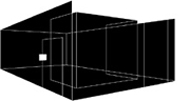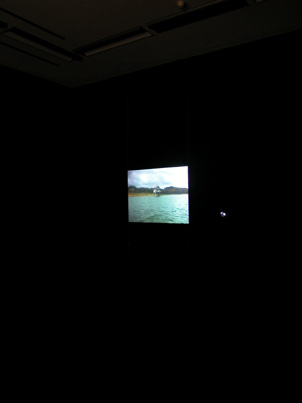|
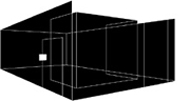 |
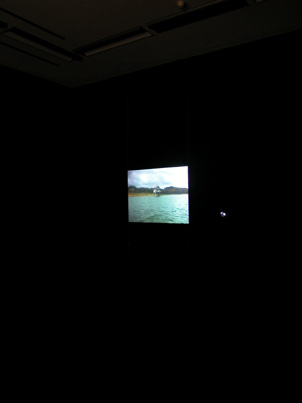 |
|
Florian Pumhösl, "Lac Mantasoa",
2000, Installationsansicht, Courtesy: Galerie Krobath Wimmer,
Wien. Foto: Rainer Iglar |
Lac Mantasoa, 2000
11:54 Min., ohne Ton
Unterwasserkamera: Daniel Abed-Navandi
Editing: Rita Hochwimmer, Torsten Heinemann
Dank an: Rajemsm Philibert, Robin Ranoarivony, Flavien Raveloson
Hochofen
Lycée Polytechnique
Kino und Theatersaal der Schule in der ehemaligen Munitionsfabrik
(nicht in Gebrauch)
Reservoir Lac Mantasoa
Privates Feriendomizil des ersten Präsidenten
Überreste der Mine und des Waldes am Grund des Stausees
"Lac Mantasoa" entstand als erste der hier gezeigten Videoinstallationen,
in denen signifikante Stadtentwicklungen in Ost- und Südostafrika
dargestellt werden. Es ist der Versuch einer visuellen Bestandsaufnahme,
die auch die Grenzen zwischen dem künstlich Geschaffenen und
dem natürlich Entstandenen erforscht. Der selektive Charakter
der Bilder wird durch die Konzentration auf ihre Präsenz im
Raum und durch den Verzicht auf Gepflogenheiten des dokumentarischen
Erzählens deutlich.
Die Abfolge von politischen und architektonischen Entwicklungen,
die mit diesen Bildern in Verbindung gebracht werden kann, verdeutlicht
den prozesshaften Charakter von Modernisierung.
Mitte des 19. Jahrhunderts stand die Merina-Dynastie,
die am Ende des 18. Jahrhunderts nahezu ganz Madagaskar unter ihrer
Herrschaft vereinigt hatte, zunehmend im Interessenkonflikt zwischen
ihrer politischen Selbständigkeit und der Öffnung gegenüber
den europäischen Kolonialmächten; diese trieben die wirtschaftliche
Ausbeutung und Missionierung voran und waren im Begriff, die noch
nicht besetzten Gebiete Afrikas untereinander aufzuteilen. Einige
Staaten, darunter auch Madagaskar, versuchten, durch selbst gewählte
Isolation den kolonialen Ambitionen entgegenzuwirken.
Die Geschichte des Industriekomplexes, den der Franzose Jean-Baptiste
Laborde zu dieser Zeit im zentralen Hochplateau etwa 60 Kilometer
östlich der Hauptstadt Antananarivo errichten ließ, ist
in jeder Geschichtsschreibung Madagaskars notiert. Geplant war eine
Industriestadt europäischen Zuschnitts: Soatsimanampiovana,
die "Schöne, die sich nicht verändert", sollte
rund um Bergbau und Industrie Wohn-, Erholungs- und Repräsentationsbauten
versammeln. Bis Laborde wegen seiner Beteiligung an einem Komplott
gegen die Merina-Regentin Ranavalona II. des Landes verwiesen wurde,
waren neben dem Erzbergwerk, einem Hochofen, seinem Wohnhaus und
einer Residenz für die Königin einige Fabrikgebäude
fertig gestellt. Dort wurden Waffen, Munition, Glas und Keramik
sowie Ziegel, Seide, Kohle und Blitzableiter hergestellt. Unmittelbar
nach Labordes Ausweisung wurden die Anlagen von Zwangsarbeitern,
die sie errichtet und betrieben hatten, zerstört.
Während der Diktatur der französischen Kolonialmacht,
die ab 1895 das Land annektiert hatte, wurde im Zuge weitreichender
Infrastrukturprojekte während der Kolonialherrschaft 1936/37
unweit des Dorfes Mantasoa ein Stausee von rund zwölf Kilometer
Länge angelegt, der einen Teil der noch übrigen Anlagen
überflutete. Er dient bis heute als Wasserreservoir für
die umliegenden Reisanbaugebiete; an seinen Ausläufern befinden
sich kleine Kraftwerke. Seither hat sich die Region um den Stausee
zu einem Naherholungsgebiet entwickelt, vorwiegend frequentiert
von der Oberschicht Antananarivos und von ausländischen Geschäftsleuten.
Das Gelände des ehemaligen Industriekomplexes wurde mehrfach
adaptiert, umgewidmet, geschliffen oder ergänzt. Die Videoaufnahmen
bilden charakteristische Ausschnitte des gegenwärtigen Bestandes
im Gebiet des Stausees und des Ortes Mantasoa ab. Unweit von dem
heutigen Ortsanfang liegen in unmittelbarer Nachbarschaft der gut
erhaltene Hochofen und die zwischenzeitlich zur Kaserne umfunktionierte
Munitionsfabrik, die dem dort ansässigen Lycée Polytechnique
(errichtet 1957) angegliedert wurde. Im ehemaligen Wohnhaus Labordes
im Zentrum von Mantasoa wird die Geschichte des Ortes in einer permanenten
Ausstellung präsentiert.
Eine der Staumauern des Reservoirs befindet sich etwa drei Kilometer
vom Ort Mantasoa entfernt; hier liegen entlang des Seeufers einige
Hotelanlagen und Villen, darunter das private Ferienhaus des ersten
Präsidenten der seit 1960 unabhängigen Republik Madagaskar,
Philibert Tsiranana; seit dessen Entmachtung 1972 verfällt
es langsam. Auf dem Grund des im Gebiet der ehemaligen Anlagen zwischen
9 und 13 Meter tiefen, grünlich-trüben Sees befinden sich
neben den Resten des vor der Errichtung weitgehend abgeholzten Baumbestands
einige Mauerfragmente, die von Anlagen zur Kohleherstellung und
dem Erzbergwerk stammen. Der Seeboden ist von einer nahezu ebenen
Schicht aus Sedimenten bedeckt.
Florian Pumhösl
|